Bilder: Werner & Mertz

Kreislaufwirtschaft
Neue Regeln, große Herausforderungen
Die europäische Verpackungsverordnung (PPWR) und die damit verbundenen gesetzlichen Vorgaben zum Einsatz von Post-Consumer-Rezyklaten (PCR) setzen viele Unternehmen unter Zugzwang. Einen Überblick über die Chancen und Herausforderungen des Verpackungskreislaufs geben Timothy Glaz, Leiter Corporate Affairs bei Werner & Mertz und Stefan Munz, Leiter Innovation & Nachhaltigkeit bei EKO-Punkt.
Der Europäische Rat hat im Dezember 2024 die Europäische Verpackungsverordnung (PPWR) formell verabschiedet, was nun die Verpackungsbranche vor große Herausforderungen stellt. Die gesetzlichen Vorgaben zum Einsatz von Post-Consumer-Rezyklaten (PCR) und zur Recyclingfähigkeit von Verpackungen setzen viele Unternehmen unter Zugzwang. Während einige mit Hochdruck an der Umsetzung arbeiten, haben andere schon langjährige Erfahrungen in der Entwicklung nachhaltiger Lösungen. So etwa das Familienunternehmen Werner & Mertz mit seiner Marke Frosch, dass seine Produkte schon lange konsequent im Sinne des Kreislaufprinzips gestaltet. Auch EKO-Punkt, das Duale System von Remondis, hat sich auf die Verbesserung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen spezialisiert. Wir sprachen mit Timothy Glaz, Leiter Corporate Affairs bei Werner & Mertz und Stefan Munz, Leiter Innovation & Nachhaltigkeit bei EKO-Punkt, über Chancen und Herausforderungen des Verpackungskreislaufs.
Die PPWR zielt darauf ab, ein zirkuläres Wirtschaftsmodell für Verpackungen zu etablieren. Welche Herausforderungen sehen Sie in der praktischen Umsetzung?
Timothy Glaz: Das Konzept Kreislaufwirtschaft denken wir bei unseren Produkten schon lange mit. Neben dem Inhalt ist die Verpackung ein wichtiger Teil unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Dabei optimieren wir das Design for Recycling kontinuierlich, und wo die Qualität es erlaubt, setzen wir Rezyklate ein. Die Qualität der recycelten Materialien aus dem Gelben Sack beziehungsweise der Gelben Tonne reicht jedoch nicht immer aus, um eine durchgängig hochwertige Wiederverwertung zu ermöglichen. Insbesondere eingefärbte Verpackungen und Mehrschicht-Materialien erschweren den Recyclingprozess. Für viele Verpackungsbestandteile, wie Polypropylen-Verschlüsse, gibt es zudem noch keine geeigneten Rezyklate am Markt. Für uns liegen die Herausforderungen also weniger im Gestalten unserer Verpackungen als in der Verfügbarkeit hochwertiger Rezyklate. Stefan Munz: Ein vollständig zirkuläres Verpackungsmanagement ist derzeit noch eine Vision der EU im Rahmen ihres Circular Economy Action Plan. Die PPWR konkretisiert diese und setzt herausfordernde Ziele, die nur durch enge Zusammenarbeit aller Akteure erreicht werden können – vom Hersteller über den Handel und die Recyclingunternehmen bis hin zum Endverbraucher, der Verpackungen besser sortieren kann, als Maschinen es in absehbarer Zeit tun werden. Deshalb muss das gemeinsame Ziel sein, Menge und Qualität der verfügbaren Rezyklate zu steigern. Die Umsetzung wird erschwert durch uneinheitliche Standards, die Vielfalt an Materialien, technische Hürden und den Konflikt zwischen wirtschaftlichen und ökologischen Interessen.
Die PPWR setzt herausfordernde Ziele, die nur durch enge Zusammenarbeit aller Akteure erreicht werden können – vom Hersteller über den Handel und die Recyclingunternehmen bis hin zum Endverbraucher.
Stefan Munz Leiter Innovation & Nachhaltigkeit EKO-Punkt

Was halten Sie von den Rezyklatvorgaben der PPWR? Sind diese in der angedachten Form denn umsetzen? Wird es genug Post-Consumer-Rezyklat für alle geben?
Glaz: Die angesetzte Mindest-Rezyklat-Quote ist aus unserer Sicht ein Kompromiss auf niedrigem Niveau. Um mehr Innovationen und Investitionen zu fördern, hätten wir statt einer Mindestanforderung einen Anreiz für mehr Rezyklat-Einsatz bevorzugt. Ganz schlicht, ein Belohnungssystem für Unternehmen, die mehr tun. So etwas fehlt gänzlich. Ob genug Rezyklat am Markt verfügbar ist, hängt von der Nachfrage und der Bereitschaft ab, höhere Preise zu zahlen. Hier braucht es eine Hochfahrphase, aber wir glauben, dass es möglich ist, genügend Rezyklate aus den vorhandenen Mengen zu gewinnen – wenn die richtigen Voraussetzungen erfüllt sind. Trotzdem erwarten wir bei der PPWR einen schwierigen Start, mit politischem Widerstand und mangelndem Änderungswillen in der Wirtschaft. Langfristig wird sich die Wirtschaft aber Lösungen erarbeiten. Munz: Die Vorgaben für den Mindestanteil an Rezyklat in Artikel 7 PPWR sind ambitioniert und was die Verfügbarkeiten von hochwertigem PCR betrifft, sind Engpässe absehbar: Laut einer Studie des Marktforschungsinstituts Conversio müssten sich die Rezyklatmengen vervielfachen, um die derzeit bekannten Anforderungen zu erfüllen. Gleichzeitig ist der Markt für Rezyklate sehr angespannt. Der Preisunterschied zu Virgin-Materialien verleitet viele Unternehmen weiterhin, ausschließlich Neuware einzusetzen. Die Durststrecke bis zur Umsetzung der PPWR ist lang. Wenn die Nachfrage weiterhin so schwach bleibt, steht zu befürchten, dass Kapazitäten abgebaut werden. Mit einer schnellen Novelle des § 21 VerpackG könnte Deutschland den Markt stabilisieren, doch durch das Aus der Ampelregierung liegt dieses Vorhaben vorläufig auf Eis.
Anzeige
Anzeige
Herr Munz, was müsste denn getan werden, um den künftigen Rezyklat-Bedarf aller Unternehmen abzudecken?
Munz: Um den zukünftigen Rezyklat-Bedarf im europäischen Kontext abzudecken, muss vor allem die Sammlung und Sortierung in vielen Mitgliedsstaaten ausgebaut und verbessert werden, damit mehr Material ins Recycling gelangt. Moderne Recyclingtechnologien sind entscheidend, um effizienter und in größeren Mengen arbeiten zu können. Anreize – oder auch Verpflichtungen – würden Unternehmen motivieren, vermehrt auf Rezyklate zu setzen, den Markt zu entwickeln und stabil zu halten. Einheitliche Qualitätsstandards und Herkunftsnachweise für Rezyklate würden zusätzlich Vertrauen schaffen und die Nutzung erleichtern, was den Markt langfristig absichern könnte. Am Anfang steht jedoch die Verpackung. Hier gilt es, Prinzipien des Design for Recycling in der Verpackungsentwicklung stärker zu fördern und Komplexität zu reduzieren. Je früher Verpackungen recyclingorientiert gestaltet und Recyclingunverträglichkeiten ausgemerzt werden, umso besser kann das Recycling gelingen.
Welche Rolle spielen Kooperationen innerhalb der Lieferkette bei der Etablierung eines geschlossenen Verpackungskreislaufs?
Glaz: Kooperationen sind entscheidend für die Kreislaufwirtschaft, denn nachhaltige Lösungen können nur durch die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten in der Wertschöpfungskette erreicht werden – vom Flaschenhersteller über den Sammler und Sortierer bis hin zum Recycler. Wichtig sind Kooperationen auf Augenhöhe, bei der jeder mit seiner Expertise beitragen kann. Alle Partner müssen bereit sein, langfristig zu denken und auch in neue Technologien zu investieren, um gemeinsame zukunftsfähige Konzepte entwickeln zu können. Munz: Das sehen wir auch so. Unser Anspruch ist es, unsere Kunden als langfristiger Partner auf dem Weg zu einem zirkulären Verpackungsmanagement zu unterstützen. Dazu gehört zum Beispiel die Prüfung von Verpackungen auf ihre Recyclingfähigkeit und das Aufzeigen von Möglichkeiten zur Optimierung des Ökodesigns. Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, im Gegenzug für ihre bei uns lizenzierten Verpackungen ein entsprechendes Mengenäquivalent an hochwertigen Post-Consumer-Rezyklaten über unser Schwesterunternehmen RE Plano zu beziehen. So schließen wir den Kreislauf und gewährleisten eine nachhaltige Wertschöpfungskette. Besonders in Zeiten knapper Rezyklat-Ressourcen bietet diese enge Zusammenarbeit eine hohe Versorgungssicherheit.
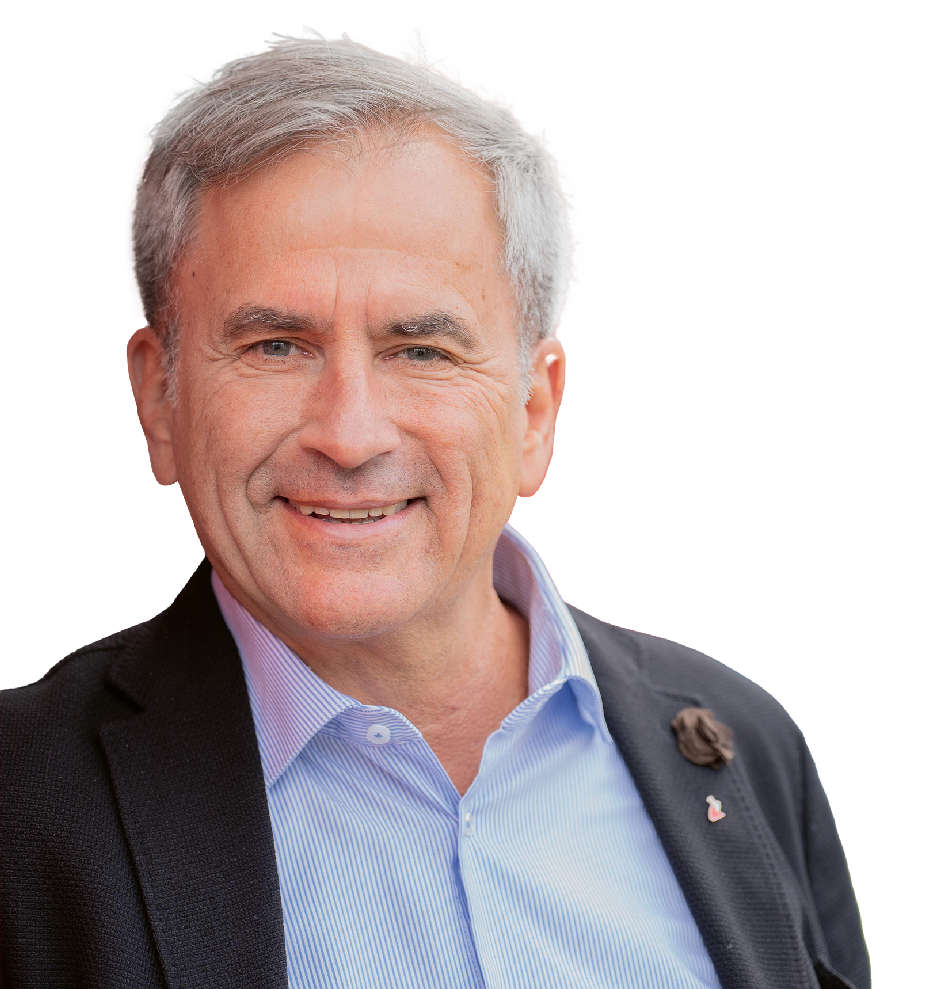
Wir optimieren das Design for Recycling kontinuierlich, und wo die Qualität es erlaubt, setzen wir Rezyklate ein.
Timothy Glaz Leiter Corporate Affairs Werner & Mertz
Herr Glaz, wie setzt sich denn das Rezyklat zusammen, das Sie in Ihren Verpackungen einsetzen und wie hoch ist der Anteil aus dem Gelben Sack/der Gelben Tonne?
Glaz: Der Ursprung des Rezyklats hat natürlich großen Einfluss auf die Nachhaltigkeit der Verpackung. Unsere Flaschenkörper bestehen aktuell zu 75 Prozent aus rPET-Rezyklat aus dem Gelben Sack und zu 25 Prozent aus der Pfandflaschensammlung. Auch wenn Rezyklat aus dem Gelben Sack oft stärker verunreinigt ist, bevorzugen wir es, weil wir so Abfälle aus dem Haushaltsstrom in den Kreislauf zurückführen. Im Jahr 2012 haben wir mit 20 Prozent rPET aus dem Gelben Sack begonnen – unser Ziel ist es, den Anteil auf 100 Prozent zu steigern. Diese Entwicklung erfordert jedoch Investitionen in Recycling-Technologien und bessere Sortierung. Auch Marktmechanismen spielen eine Rolle: Höhere Nachfrage nach hochwertigem Rezyklat würde zu einer besseren Ausbeute führen.
Haben Sie einen Eindruck, wie gut Verpackungshersteller bereits für die PPWR aufgestellt sind? Laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren oder werden viele Unternehmen erst im letzten Moment auf die neuen Regelungen umstellen wollen?
Munz: Größere Verpackungshersteller hatten hier lange die Nase vorn. Die Deloitte Packaging Study 2023 belegt beispielsweise, dass größere Verpackungsunternehmen gezielt in nachhaltige Lösungen und Kreislaufstrategien investieren, während kleinere Betriebe oft Ressourcenengpässe haben und die Anpassungen an die PPWR zögerlicher angehen. Wir beobachten dies mit etwas Abstand. Aktuell scheint sich hier aber eine starke Dynamik zu entwickeln. Die kleineren lernen schnell und holen zügig auf.
Wie sieht es bei Werner & Mertz aus? Werden Sie die Vorgaben der PPWR bereits erfüllen, bevor sie in Kraft treten?
Glaz: Das werden wir. Unser Nachfüllpack ist bereits zu rund 90 Prozent hochwertig recyclingfähig – das attestiert uns das Institut HTP-cyclos. Allerdings hängt die Wiederaufbereitung in der Praxis von der Recycling-Infrastruktur ab, da hochwertige Recyclingmöglichkeiten nicht immer vorhanden sind. Unsere Flaschen sind schon heute hochwertig recyclebar, aber die Verschlusskappen oft noch nicht. Um auch dieses Detail zu meistern, haben wir die Farbe aus unseren Kappen entfernt, was ihre Recyclingfähigkeit erhöht. Leider folgen andere Marktteilnehmer diesem Beispiel noch nicht, was die Umstellung erschwert. Dennoch zeigen wir, dass eine transparente Gestaltung möglich und wirtschaftlich vorteilhaft ist. Solange jedoch Verbraucher graue Recyclingprodukte skeptisch betrachten, bleibt die Umsetzung eine Herausforderung.

